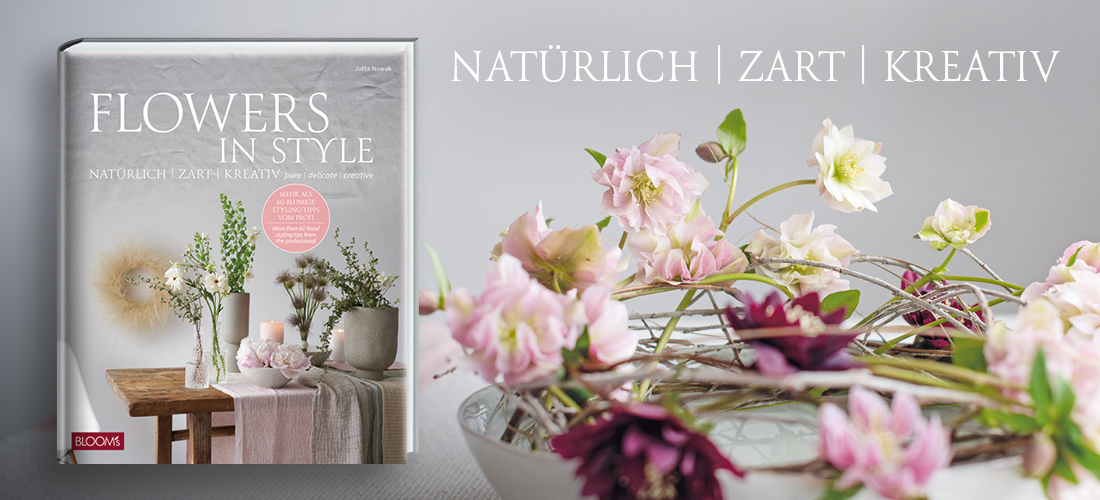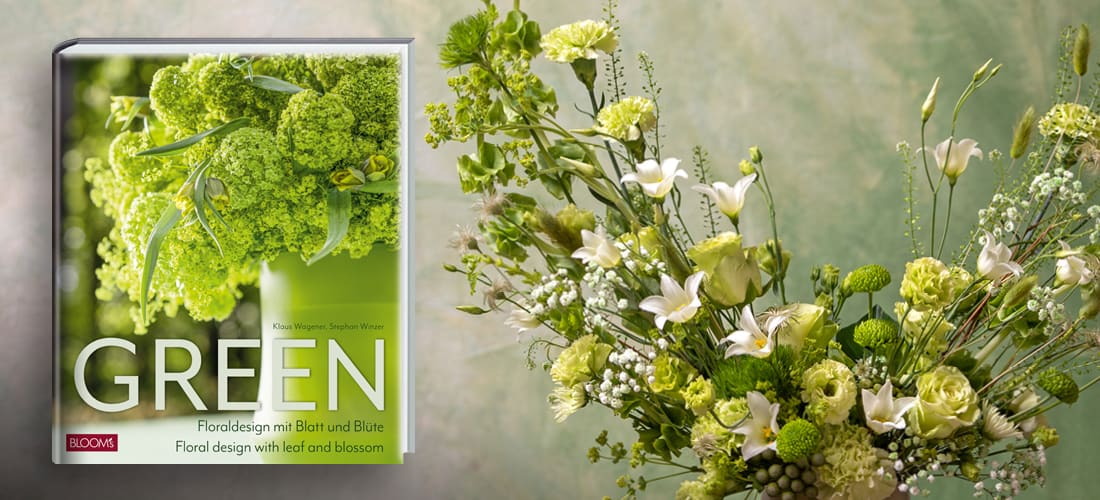Die formal-lineare Gestaltungsart wird auch grafisch genannt, da in ihr Linien von Wuchsbewegungen dominieren, die wie gezeichnet erscheinen. Auch flächige und körperhafte Formen können bestimmend sein. Meist sind es die Formenkontraste (z.B. gerade-gebogen oder linear-körperhaft), die den gestalterischen Reiz ausmachen.
Folgende Regeln finden Beachtung:
- Die Ordnungsart Asymmetrie ist vorrangig. Dadurch wird ein spannungsreiches Gestalten mit dynamischer Formgebung möglich. Symmetrie kann vorkommen, wenn ansonsten eine deutliche formal-lineare Ausprägung entsteht.
- Eine Beschränkung auf wenige Werkstoffe ist besonders deutlich. So bleiben die Einzelformen in ihrer Gestalt erkennbarer. Allerdings ist eine Massierung (mengenmäßiges Verstärken eines Werkstoffs) denkbar, wenn dadurch die formal-lineare Wirkung entsteht. Vergleiche dazu weiter unten: Formation.
- Großzügige Freiräume lassen die Bewegungsformen klar erkennen. Diese Regel steht in direktem Zusammenhang mit der vorhergehenden, sie bedingen einander. Fehlt der notwendige Freiraum, ist z. B. die Wuchsbewegung eines Werkstoffstiels nicht mehr sichtbar. Auch hier bildet die Formation bzw. Massierung die Ausnahme.
- Formkontraste steigern die Wirkung. Der gestalterische Ausdruck einer Form wird besonders hervorgehoben, wenn eine grundsätzlich andere Form damit kontrastiert. Ein Blatt wirkt noch flächiger neben einer körperhaften Kugel, der gerade Spross ist in Kombination mit gedrehten oder brüchigen Zweigen besonders spannungsreich.
- Eine Formation ist möglich und steigert die Wirkung. Als Formation bezeichnet man ein dichtes Nebeneinander gleichförmiger und gleichartiger Werkstoffe in größerer Menge. Sie entspricht der oben erwähnten Massierung. Die Wirkungssteigerung entsteht durch Gleichheit und vielfache Wiederholung einer Form.
- Werkstoffe können gestalterisch verändert werden. Da es nicht auf eine natürliche Wirkung, sondern auf Formgestaltung ankommt, ist die Veränderung gegebener Formen zum Erreichen einer gestalterischen Wirkung möglich. Zerteilen, Verbiegen, Aufrollen etc. werden eingesetzt.
- Nicht-natürliche Schmuckmittel finden Verwendung. Wieder ist die Form der Gestaltungsmittel wichtig, nicht die Natürlichkeit. Fließende Bänder, lagernde Kugeln, aufstrebende Metallstangen, flächige Bleche usw. können verarbeitet werden.
- Das Gefäß hat besondere Bedeutung als gestalterisch wirksame Form. Diese Regel ergibt sich aus der Reduktion auf wenige Werkstoffe, denn so bleibt das Gefäß sichtbar. Mit seiner technisch konstruierten Form eignet es sich besonders gut als Kontrast zu den organisch gewachsenen, pflanzlichen Formen.
Der gestalterische Reiz dieses Gestecks liegt in den kontrastierenden Formen. Die Farbwahl verstärkt diesen Effekt noch.
Wie ein einziger, kompakter Block wirken die Schachtelhalme. Daraus erheben sich weitere Werkstoffe in grafischer Parallelität. So sind sie eher stilisiert als natürlich verarbeitet und doch ist ihre Einzigartigkeit und Besonderheit betont.
Links kontrastieren die Linien der Blatt- und Rankenformen mit den Quadraten von Platten und Gefäß. Verbindung schafft eine gemeinsame schräge und parallele Ausrichtung. Aufstrebend sich allseitig entfaltende Iris werden nahezu ausschwingend verarbeitet und von spiralig-quirligem Peddigrohr im schiffförmigen Gefäß gehalten.
Vielfältige Kontraste in Form, Farbe und Textur charakterisieren diese formal-linearen Gestecke mit großen Freiräumen. Eine besondere Rolle spielen die dunklen Gefäße mit ihrer optischen Schwere. Sie geben auch den ausladenden pflanzlichen Werkstoffen genügend Halt.
Diese Gestecke sind bis auf wenige Gestaltungsmittel reduziert. Zarte, leichte Blütenstiele wachsen aus Kugeln empor, die ihrerseits aus linearen Werkstoffen geformt sind. Die parallele Anordnung und aufstrebende, lineare Bewegungen kontrastieren zur Kugelform.
Weitere Techniken findet ihr im „BASICS Lernbuch Gestecke“ von Karl-Michael Haake in unserem Shop.