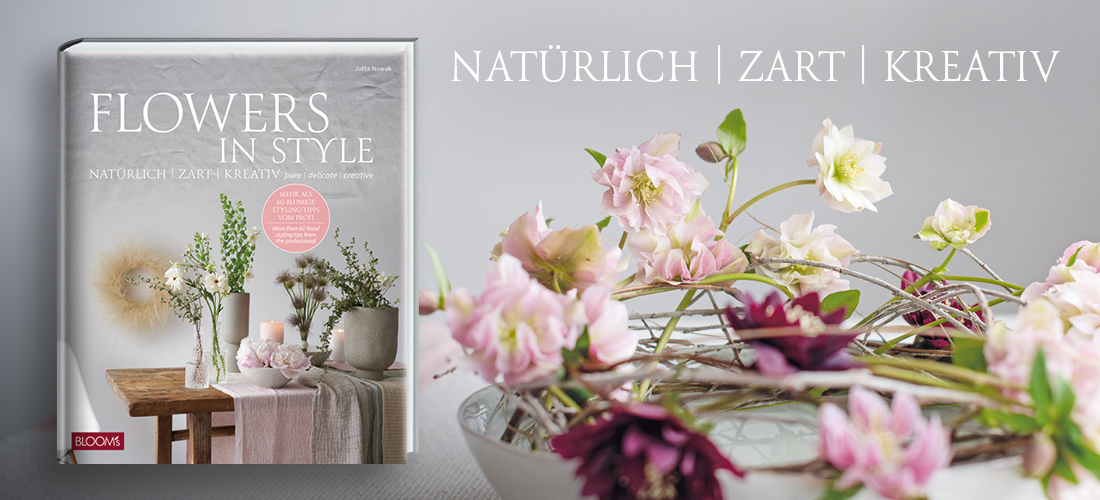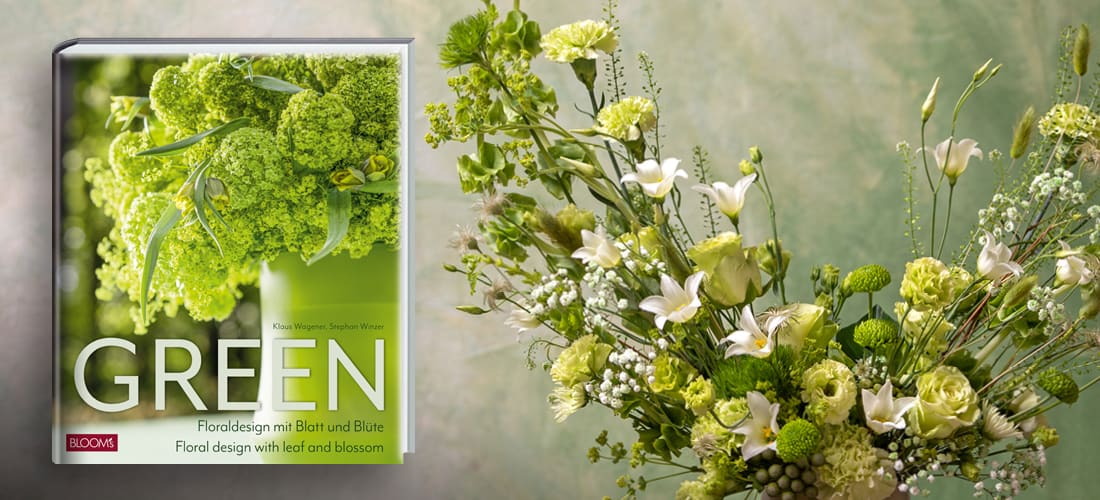Zimmerpflanzen und Freilandpflanzen werden in der Floristik verarbeitet und vermarktet. Solange sie vorrätig gehalten werden, müssen sie entsprechend der durch ihre natürliche Herkunft geprägten Ansprüche gepflegt werden. Im Übrigen müssen Käufer beraten werden, d. h. das Wissen um die Pflegeansprüche der Arten und Sorten ist unerlässlich. Im Folgenden werden die generellen Pflegebedingungen von Pflanzen erläutert, wobei die umfangreichen Aspekte des Pflanzenschutzes entfallen, da sie die Thematik der floristischen Techniken bei Weitem übersteigen.
Wasserversorgung
Die Versorgung von Pflanzen mit Wasser erfolgt im Wesentlichen durch Gießen oder Eintauchen des Topfs mit dem Wurzelballen. Bei manchen Arten ist Übersprühen erforderlich, z. B. bei Bromelien im Blatttrichter- und bei Orchideen im Wurzelbereich. Das Tauchen ist zur vollständigen Durchdringung mit Wasser günstig, wenn ein Wurzelballen besonders trocken geworden ist. Ansonsten ist Gießen vorzuziehen, da es in der Regel einfacher und schneller erfolgen kann. Außerdem werden beim Tauchen zu viele Nährstoffe aus dem Substrat geschwämmt.
Generell gelten bei der Wasserversorgung folgende Regeln:
- Die Qualität des Gießwassers bezüglich pH-Wert und Kalkgehalt (Wasserhärte) muss beachtet bzw. durch entsprechende Maßnahmen an die Ansprüche der Pflanzen angepasst werden.
- Die Temperatur des Gießwassers sollte möglichst den Regenwassertemperaturen des natürlichen Umfelds der Pflanzen entsprechen. Sommerliche Leitungswassertemperaturen sind meist in Ordnung. Ansonsten ist Zimmertemperatur richtig.
- Der Wasserbedarf der jeweiligen Pflanzen ist in Wassermenge und Gießrhythmus zu beachten. Er ist den Bedingungen am natürlichen Standort der Art und dem tatsächlichen Standort der einzelnen Pflanze anzupassen, z. B. im Garten, in der Sonne, im Schatten, am Zimmerfenster usw.
- Ein regelmäßiger Gießrhythmus ist einzuhalten. Er richtet sich nach der Pflanzenart, den Vegetationsperioden, im Freiland nach den aktuellen Witterungsbedingungen und bei Zimmerpflanzen nach den Raumbedingungen.
- Vegetationsphasen, d. h. vor allem Trocken- bzw. Ruhephasen, sind einzuhalten.
- Eine gleichmäßige Durchfeuchtung des Wurzelbereichs ist anzustreben. Das völlige Austrocknen des Wurzelballens ist, außer bei Kakteen bzw. Sukkulenten, zu vermeiden.
- Staunässe, d. h. überständiges, in einem Übertopf oder in einer Pflanzschale länger verbleibendes Wasser, darf keinesfalls entstehen, denn es führt zu Fäule und Absterben der Wurzeln.
- Das Benetzen von Blättern und vor allem von Blüten mit Wasser ist bei empfindlichen Pflanzen, die darauf z. B. durch Fleckenbildung, Schimmel und Fäulnis reagieren, zu vermeiden.
Düngerversorgung
Düngemittel ersetzen die Nährstoffe, die eine Pflanze dem Substrat entzogen hat. Man unterscheidet Dünger nach Kriterien wie Formulierung, Wirkzeit, Ursprung, Inhaltsstoffe, Pflanztechnik und Pflanzengruppen bzw. -eigenschaften.
Dazu einige Beispiele: Flüssigdünger, Dünger in fester Form (z. B. Granulate, Stäbchen), anorganisch-mineralische Dünger, organische Dünger (z. B. Hornspäne und Guano), Langzeit- bzw. Depotdünger, Volldünger mit allen wichtigen Nährstoffe (N, P, K plus wichtige Elemente und Spurenelemente), Einzelnährstoffdünger, Dünger für Blüh- und Grünpflanzen, Orchideen, Kakteen etc.
Beim Düngen sind folgende Kriterien zu beachten:
- Die Pflanzenart mit ihrem jeweiligen Nährstoffbedarf, z. B. Grünpflanze, Sukkulente, Blühpflanze etc.
- Der Entwicklungszustand der Pflanze, z. B. Setzling, Jungpflanze, Pflanze in voller Blüte etc.
- Wurzelballenbeschaffenheit, d. h. es darf nie auf trockenen Ballen gedüngt werden, da hierbei zumindest kurzfristig die Nährionenkonzentration zu hoch wäre und die Wurzelzellen schaden nehmen würden.
- Die Vegetationsperioden bzw. die Ruhezeiten von Pflanzen.
- Die Art (siehe oben) und Formulierung des Düngers, z. B. flüssig, konzentriert, anwendungsfertig aufbereitet, granuliert etc.
- Die Düngerkonzentration bzw. -menge und dementsprechend ausreichende Intervalle zwischen den Düngergaben.
Die meisten Mineraldünger müssen verdünnt bzw. aufgelöst und mit dem Gießwasser verabreicht werden. Organische Dünger, wie Hornspäne, werden unter die Erde gemischt. Langzeitdünger, z. B. in Form von Düngestäbchen oder als Granulat, sind so eingestellt, dass sie die Nährstoffe nach und nach abgeben, wodurch die Überdüngungsgefahr vermindert ist.
Überdüngung führt durch erhöhte Nährsalzionenkonzentration im Erdbereich gegenüber den Wuzelhaarzellen zur Umkehrosmose. Die folgende Plasmolyse in den Wurzelzellen bedingt dann so genannte Salzschäden an den Pflanzen, die schließlich wie verbrannt erscheinen und absterben. Durch rechtzeitiges Auswässern kann eine überdüngte Pflanze unter Umständen noch gerettet werden.
Lichtversorgung
Der Lichtbedarf von Pflanzen richtet sich selbstverständlich ebenfalls nach den Bedingungen am ursprünglichen Standort der jeweiligen Pflanzenart. Die Sonnenlichtintensität, die z. B. durch Wolken, Nebel oder die Schattierung durch Bäume mitbestimmt wird, und die Tageslänge sind demnach zu bedenken. Der tatsächliche Standort der Pflanze ist danach zu wählen.
Im Garten geht es dabei im Wesentlichen um Licht- und Schattenplätze. Zu beachten ist auch, wann der Sonnenschein auf die Pflanze trifft, denn Mittagssonne ist intensiver als Morgensonne. Eine allmähliche Erhöhung der Lichtintensität und damit auch der Temperatur ist in der Regel für Pflanzen verträglicher, als die kurzfristige Wanderung der Schattengrenze in der Mittagszeit im Sommer. Dabei würde eine Pflanze innerhalb weniger Minuten vom kühlen Schatten in das heiße Sonnenlicht geraten.
Für Zimmerpflanzen ist zunächst die Fensterausrichtung wichtig. Südfenster sind sonnenintensiv, Nordfenster eher dunkel, Ostfenster bekommen Morgensonne bis zum Mittag, Westfenster erfahren eine plötzliche mittägliche Sonneneinstrahlung mit schneller Aufheizung. Außerdem ist der Abstand des Pflanzenstellplatzes vom Fenster entscheidend. Hinter Glas ist die Bestrahlung schwächer als im Freiland, im Winter bis zu 50 %. Bromelien z. B., die im heimischen Regenwald als Epiphythen in der Region der Baumkronen auf Ästen aufsitzen, benötigen mindestens diese Helligkeit. Im Abstand von 50 cm ist die Lichtintensität bereits auf etwa 30 % gesunken, bei 1 m auf etwa 20 %. Schattenpflanzen kommen damit gerade noch zurecht. Kommen Fenstergardinen hinzu, reicht das Licht nicht mehr aus. Ab 2 m Raumtiefe ist das für Menschen noch ausreichende Licht für Pflanzen bereits mit nahezu völliger Dunkelheit gleichzusetzen.
Säubern von Pflanzen
Pflanzen müssen von Zeit zu Zeit vom Staub auf den Blättern befreit werden. Dabei geht es nicht nur um das Aussehen, sondern auch und vor allem um die Vermeidung der Verdunklung, die die Staubschicht auf den Blättern verursacht. Der Staub wirkt sich wie ein über die Pflanze gebreitetes Tuch aus, das die Fotosynthese einschränkt. Eine Behinderung der Kohlendioxidaufnahme und der Sauerstoffabgabe durch den Staub liegt nicht vor, da die dafür im Wesentlichen bedeutsamen Spaltöffnungen in aller Regel auf den Blattunterseiten zu finden sind.
Übersprühen mit Wasser ist die einfachste Methode, Pflanzen zu säubern bzw. zu entstauben. Pflanzen mit wenigen großen Blättern kann man auch Blatt für Blatt mit einem feuchten Tuch reinigen. Diese Methode ist aus Kostengründen in der Regel nur von Kunden sinnvoll anwendbar. Im Floristikbetrieb kann sie bei Fertigstellung einer Pflanzung vor Auslieferung dennoch notwendig sein, um ein einwandfreies Werkstück abzugeben.
Blattglanz wird als Pflanzenpflegeprodukt in Form von ölhaltigem Spray angeboten und sorgt für eine glänzende Erscheinung der Blattoberflächen. Der Blattglanzeinsatz erfolgt durch unmittelbares Aufsprühen aus einem Abstand von mindestens 20 cm oder, ähnlich wie zuvor erläutert, durch Abwischen der Blätter mit einem mit Blattglanz besprühten, weichen Tuch. Die Blattunterseiten sollten nicht mit Blattglanz benetzt werden, da hier ein Verstopfen der Spaltöffnungen die Folge sein kann, so dass der Gasaustausch behindert würde. Pflanzen mit empfindlichen Blättern, z. B. Farne, sowie grundsätzlich alle Blüten vertragen keinen Blattglanz. Im Übrigen dürfen Blätter, die von Natur aus keine glänzende Oberfläche zeigen oder z. B. behaart sind, ohnehin nicht damit besprüht werden, denn so würde das natürliche Aussehen gestört. Das Aufsprühen von Blattglanz darf nicht die Säuberung der Blätter ersetzen. Verbleibt der Staub nämlich auf dem Blatt, wird er durch Aufsprühen von Blattglanz noch zusätzlich klebrig verfestigt und es bildet sich auf Dauer erst recht eine die Lichtaufnahme dämpfende Schmutzschicht. Das Abwischen mit blattglanzgetränktem Tuch bleibt aber möglich. Das auf ein sauberes Blatt aufgetragene Blattglanzspray kann durch die Glättung der Oberfläche die erneute Staubablagerung in gewissem Maße vermindern.
Blattglanz wird teils auch zum Säubern von Schnittgrünblättern eingesetzt. Bei Werkstücken, die mit Stoffen, z. B. Tischwäsche und Brautkleid, in Berührung kommen können, muss auf den Blattglanz verzichten werden, da sonst Ölflecken im Stoff die Folge sein könnten.
Den zweiten Teil zum Thema „Techniken der Pflanzenpflege“ findet ihr hier.
Mehr findet ihr im „BASICS Lernbuch Techniken“ von Karl-Michael Haake in unserem Shop.